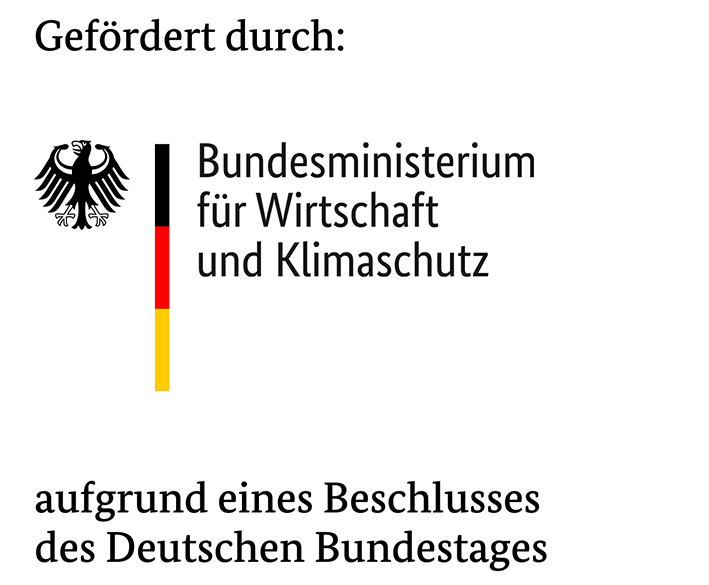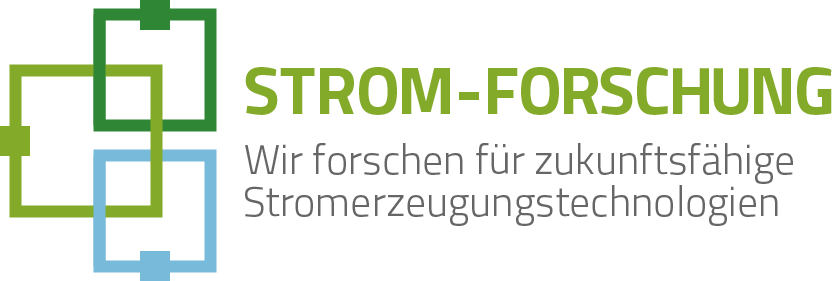Reallabor der Energiewende IW3
Quartiere nachhaltig mit Wärme versorgen
Während Strom in Deutschland mit einem Anteil von etwa 50 Prozent schon zu großen Teilen aus regenerativen Energien gewonnen wird, basiert die Wärme- und Kälteversorgung noch immer weitestgehend auf fossilen Energieträgern. Eine erfolgreiche Wärmewende kann daher einen bedeutenden Beitrag zum Gelingen der Energiewende leisten.
Laut einer Studie im Auftrag des Umweltbundesamtes könnte bis 2050 durch mitteltiefe und tiefe Geothermie eine Jahresenergiemenge von 150 Terawattstunden erreicht werden. Wer dabei nur an die tiefengeothermischen Projekte in Süddeutschland denkt, irrt: Das Norddeutsche Becken mit großen hydrothermalen Ressourcen könnte dabei eine entscheidende Rolle spielen. Wie dies gelingen kann, wird im Reallabor der Energiewende „Integrierte WärmeWende Wilhelmsburg“, kurz IW³, in Hamburg erforscht und demonstriert. In dem Format Reallabore der Energiewende werden zukunftsweisende Projekte im industriellen Maßstab umgesetzt. Im Energieforschungsprogramm sollen sie als Förderformat den Praxistransfer von innovativen Technologien und Verfahren für die Energiewende unterstützen und den Umbau des deutschen Energiesystems beschleunigen.
Ganzheitliche Betrachtung des urbanen Wärmesystems
Die Gewinnung und Verteilung regenerativer Wärme im urbanen Raum ist aufgrund der hohen Kosten für die benötigten Flächen, Infrastrukturen und Erzeugungsanlagen bislang nur schwer umsetzbar. Hier setzt IW³ an. Die Elbinsel Wilhelmsburg ist der flächenmäßig größte Stadtteil Hamburgs. Mit über 50.000 Einwohnern und aufgrund seiner geografischen Lage ist Wilhelmsburg in vielen Bereichen mit einer mittelgroßen Stadt zu vergleichen. Das Reallabor der Energiewende soll verdeutlichen, wie auch in Groß- und Mittelstädten mit innovativen Technologien und Geschäftsmodellen eine klimaschonende, energieeffiziente und bezahlbare Wärmeversorgung möglich ist. Neue Erzeugungs- und Speichertechnologien, intelligente Sektorkopplung und innovative Geschäftsmodelle bieten die Grundlage für große CO2-Einsparungen und ermöglichen so eine nachhaltige Transformation der Wärme- und Kälteversorgung.
IW³ verfolgt dabei ein integratives Konzept. Die zugrundeliegende Idee, ein städtisches Wärmesystem nachhaltig zur transformieren, wird ganzheitlich betrachtet: Erzeugungsseite, Systemintegration und Marktseite greifen ineinander. Bestehende und neue regenerative Erzeuger werden miteinander kombiniert und in ein virtuelles Kraftwerk integriert. Innovative Konzepte bieten die Möglichkeit, Energie aus unterschiedlichen Quellen und von verschiedenen Anbietern transparent, automatisiert und effizient zu handeln. Die Sektoren Wärme, Strom und Mobilität werden intelligent miteinander gekoppelt.
Geothermische Potentiale im urbanen Raum nutzen
Ein wichtiger Bestandteil von IW³ ist der Bau einer Geothermie-Anlage. Mit dieser soll zukünftig aus einer Thermalwasser-Lagerstätte in einer Tiefe von rund 1.300 Metern geothermische Energie gewonnen und in das Fernwärmenetz eingespeist werden.
Zunächst war das Projekt als tiefe Geothermie geplant worden. Ursprüngliches Zielreservoir waren Sandsteine, die entsprechend der Vorerkundung in rund 3.200 Metern Tiefe erwartet wurden. Im Frühjahr 2022 wurde die erste Erkundungsbohrung bis zu einer Endteufe von 3.067 Metern niedergebracht. Eine zu geringe Mächtigkeit des ursprünglichen Zielreservoirs führte allerdings zu einer Umplanung. Da die Temperatur des mitteltiefen geothermischen Reservoirs für die erforderliche Heizwassertemperatur im Fernwärmenetz nicht ausreichend ist, wird eine Wärmepumpenanlage errichtet.
Sie soll in zwei Strängen mit jeweils mehreren Wärmepumpen ausgeführt werden, um den vorwiegend jahreszeitlich bedingten Schwankungen in der Abnahmeleistung Rechnung tragen zu können. In Kombination mit einem Blockheizkraftwerk soll ein möglichst hoher Wirkungsgrad und entsprechend niedrigerer Stromverbrauch erzielt werden. Aus einer Tiefe von circa 1.300 Metern können in Hamburg-Wilhelmsburg rein rechnerisch über 6.000 Haushalte mit Wärme aus der neuen Geothermie-Anlage versorgt werden.
Weitere Erzeugungs- und Speicher-Komponenten sind in Wilhelmsburg bereits vorhanden und können bedarfsgerecht in das System eingebunden werden. Solarthermie, Biomethan und Industriewärme zur regenerativen Wärmeversorgung werden mit stromerzeugenden Windenergie- und Photovoltaik-Anlagen über eine neue Koppelstelle miteinander verbunden.
Die Leitung, mit der die Geothermie-Anlage an den Wilhelmsburger Energiebunker angeschlossen werden kann, ist seit September 2023 im Bau. Der Bau des Geothermie-Heizhauses startet im Frühjahr 2024. Erdwärme soll dann ab 2025 geliefert werden.
Im Vergleich zur tiefen Geothermie hat die mitteltiefe Geothermie den Vorteil, dass die Bohrkosten, Bohrrisiken und Projektentwicklungszeiten deutlich geringer sind. Diese Punkte sprechen für eine Skalierbarkeit. Bei der Planung der ersten Geothermie-Anlage wurde räumlich und technisch bereits eine zweite Brunnendublette berücksichtigt, so dass bei steigendem Wärmebedarf im Zuge der Verdichtung des Wärmenetzes und der Erschließung von Neubaugebieten mit wenig Aufwand eine weitere Erdwärmequelle erschlossen werden kann.
Digitale Unterstützung
Neben den baulichen Aspekten setzt IW³ auf eine konsequente digitale Vernetzung. So soll die Erzeugung und die Abnahme von Wärme sowie die Schnittstelle zwischen Wärme- und Strommarkt so effizient wie möglich gestaltet werden. Ein digitales Wärmenetz verbindet die unterschiedlichen Erzeuger. Diese werden über ein gemeinsames Leitsystem koordiniert, ähnlich wie in einem virtuellen Kraftwerk. Durch detaillierte Prognosen des Wärmeabsatzes und -bedarfs kann so der Einsatz der einzelnen Anlagen optimal gesteuert werden. Diese Systemintegration ist eine entscheidende Maßnahme für den effizienten Betrieb eines grünen Wärmesystems.
Zur Planung und Prognose setzen die Projektpartner neueste digitale Technologien ein. Mit Hilfe von Machine Learning, welches ein praxisbezogener Bereich der Künstlichen Intelligenz ist, modellieren sie das komplexe Zusammenwirken der Anlagen des Fernwärmenetzes. Als Ergebnis entsteht ein „Digitaler Zwilling“. Mit diesen Möglichkeiten können die Partner sowohl auf die fluktuierenden erneuerbaren Energien als auch auf den steten Ausbau des sektorgekoppelten Systems reagieren.
Die Forschenden untersuchen außerdem neuartige Wärme- und Flexibilitätsmärkte und erproben ein Pilotregister für das kommende Herkunftsnachweisregister für Wärme.
Auf geeignete Städte in Deutschland übertragbar
Das Reallabor in Wilhelmsburg kann als Leuchtturm für einen nachhaltigen Umbau von urbanen Räumen Strahlkraft auch über Hamburg hinaus entwickeln. Die hier angewandten Technologien und Verfahren können in Zukunft als Vorlage für Quartiere und Städte in ganz Deutschland herangezogen werden. Insbesondere mit Blick auf die Nutzung geothermischer Energie, die bislang aufgrund hoher wirtschaftlicher Risiken bei der Erschließung nur an wenigen Orten in Deutschland umgesetzt wurde, könnte Wilhelmsburg zu einem Pilotstandort entwickelt werden.