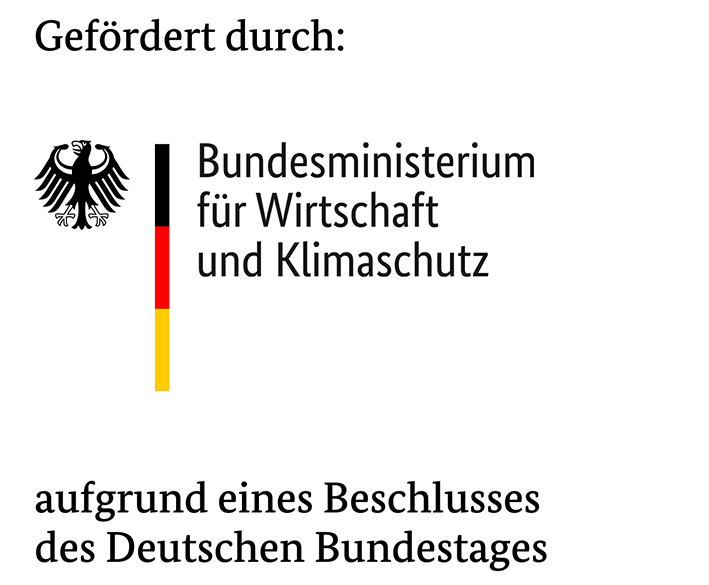Energiewende im Quartier
Zukunftstechnologien und Konzepte für die Wärmewende
Bei der Forschungsinitiative EnEff:Wärme geht es um neue Netzkonzepte und um die Entwicklung innovativer Technologien. Sie sollen die Wärmeversorgung energetisch, wirtschaftlich und ökologisch deutlich verbessern. Die einführenden Beiträge von Projektträger und BMWi verdeutlichten, dass EnEff:Wärme mit zur Zeit über 100 Projekten künftig verstärkt im Kontext der neuen Förderinitiative "Solares Bauen/Energieeffiziente Stadt" steht, die mit 150 Mio. Euro an zusätzlichen Mitteln ausgestattet ist - zusätzlich zum jährlichen Aufwuchs der Forschungsfinanzierung aus dem Bundeshaushalt. Mit dieser Projektförderung soll die Forschung neue Themen aufgreifen und mit komplexen Problemlösungen zur Energiewende auch im Bereich der Wärme- und Kälteversorgung beitragen. Und im Transfer von Erkenntnissen in die Praxis ist neben der Forschungskommunikation das Forschungsnetzwerk "Energie in Gebäuden und Quartieren" eine wichtige Schaltstelle. Neben den Zielen und Inhalten der neuen Förderinitiative wurde auch das Antrags-Verfahren detailliert erläutert.
Forschung unterstützt Stadtwerke - konkret und strategisch
Die Sichtweise und die Anforderungen der Praxis prägten vor allem die Diskussionsrunde von Stadtwerke-Vertretern aus Rosenheim, Düsseldorf, Jena, Kassel, Oberhausen und Ludwigshafen. Dabei ging es um die teils nur schwer einzuschätzenden politischen und marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Aktivitäten und Investments von Stadtwerken, um den Stellenwert der sogenannten Sektorkopplung von Strom und Wärme, die notwendige Tempoerhöhung im Bereich der Wärmewende und nicht zuletzt um konkrete Projekterfahrungen und deren Übertragbarkeit. In einem Punkt herrschte Einigkeit: Forschung und Entwicklung schafft die Möglichkeiten, Neues zu erproben, beispielsweise die Optimierung des eigenen Kraftwerksparks und Kraftwerkseinsatzes. Und: Ein kontinuierlicher Austausch mit Forschern aus Stadt und Region weitet den Blick in einer immer komplexer werdenden Wettbewerbssituation für Stadtwerke als den wenigen - in Folge der Marktliberalisierung verbliebenen - "Querverbund-System optimierern".
Erfahrungen aus EnEff:Wärme schöpfen
Die weiteren Veranstaltungbeiträge stellten aktuelle EnEff:Wärme-Projekte vor:
- Praxiserprobung eines regionalen virtuellen Kraftwerks
- Nahwärme aus Abwasser im Neckarpark Stuttgart
- Kältelieferung unter 0°C mit KWKK — Anlagenkonzept und Realisierung
- Absorptionskältetechnik zur Klimatisierung im Einsatz
- Systeme zur solarunterstützten Kraft-Wärme-Kopplung
- Wärmespeicher und Power-to-Heat in der Fernwärmeversorgung
- LowExTra — Niedrig-Exergietrassen zum Speichern und Verteilen von Wärme auf verschiedenen Temperaturniveaus
- Vor-Ort-Kalibrierung von Durchflussmessgeräten.
Aus der aktuellen Fernwärmeforschung wurde über das Vorhaben "Technische Gebrauchsdaueranalyse - Auswirkungen dezentraler Einbindung von Wärme" berichtet. Ergänzt wurde das Informationsangebot durch einen komprimierten Überblick über Aktivitäten im Rahmen der Internationalen Energieagentur (IEA-DHC). Sie widmen sich vorwiegend dem Erfahrungsaustausch mit internationalen Forschungspartnern, beispielsweise zum Thema "Solar District Heating" oder zur Frage, wie die Umstellung auf Niedertemperatur-Fernwärmenetze gelingen kann.
Zum Abschluss des Statusseminars spannte ein Vortrag der neuen Begleitforschung den weiten Bogen von der zunehmenden Vernetzung von Gebäuden über die modellbasierte Gesamtoptimierung von Wärme- und Kältenetzen im Quartier bis hin zu skalierbaren Lösungen für eine nachhaltige Stadtentwicklung.
Die Vorträge des Statusseminars "Energieforschung für die Wärmewende":
Energieforschung im politischen Kontext
Dr. Rodoula Tryfonidou, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
Impulse aus dem Forschungsnetzwerk Energie in Gebäuden und Quartieren
Kerstin Lorenz, Projektträger Jülich
„Energieversorger kommen zu Wort“ - Erfahrungsberichte und moderierte Diskussion Moderation Dipl.-Ing. Carsten Beier, Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT
Praxiserprobung eines regionalen virtuellen Kraftwerks
Dr. Joachim Seifert, Technische Universität Dresden Alexander Tolksdorf, EWE Aktiengesellschaft
Nahwärme aus Abwasser im Neckarpark Stuttgart
Hans Erhorn, Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) Dr. Jürgen Görres, Landeshauptstadt Stuttgart
Kältelieferung unter 0 °C mit KWKK — Anlagenkonzept und Realisierung
Prof. Dr. Ullrich Hesse,Technische Universität Dresden
Absorptionskältetechnik zur Klimatisierung im Einsatz
Stefan Petersen,Technische Universität Berlin Jürgen Disqué, Stadtwerke Karlsruhe
Systeme zur solarunterstützten Kraft-Wärme-Kopplung
Dirk Mangold, Solites Steinbeis Forschungsinstitut für solare und zukunftsfähige thermische Energiesysteme
Wärmespeicher und Power-to-Heat in der Fernwärmeversorgung
Dipl.-Ing. Andreas Christidis,Technische Universität Berlin
LowExTra — Niedrig-Exergietrassen zum Speichern und Verteilen von Wärme auf verschiedenen Temperaturniveaus
Prof. Dr. Martin Kriegel, Technische Universität Berlin
Vor-Ort-Kalibrierung von Durchflussmessgeräten
Dr. Michael Dues, ILA Intelligent Laser Applications GmbH Dr. Ulrich Müller, OPTOLUTION Messtechnik GmbH
Technische Gebrauchsdaueranalyse - Auswirkungen dezentraler Einbindung von Wärme
Andreas Büchau, Vattenfall Europe Wärme AG
Aktivitäten im Rahmen der Internationalen Energieagentur (IEA-DHC)
Dr. Dietrich Schmidt, Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP)
Energie in Gebäuden und Quartieren — Quo vadis?
Prof. Dr. Dirk Müller, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen